von Peter Surber, 02.07.2018
Oper mit Migrationshintergrund
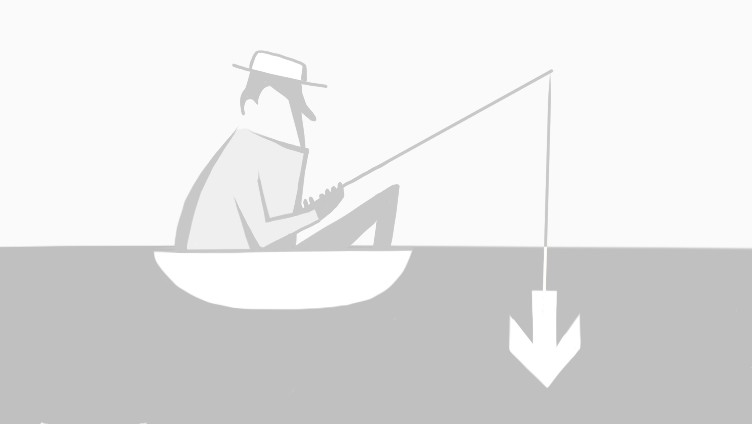
«Edgar», die diesjährige St.Galler Festspieloper, ist eine üble Mobbinggeschichte. Das Opfer: eine Flüchtlingsfrau. Darf man so etwas heute noch aufführen? Man kann zumindest – wenn es wie hier auf dem Klosterhof reflektiert geschieht.
Von Peter Surber
Die St.Galler Festspiele präsentieren einmal mehr eine Ausgrabung – ein Stück, das es kaum je auf die Spielpläne der Opernhäuser schafft. «Kein Wunder, bei der Story»: Diese Publikumsreaktion hörte man nach der Premiere mehr als einmal. Tatsächlich transportiert die Geschichte, die Giacomo Puccini vor rund 130 Jahren vertont hat, mehr als das opernübliche Mass an Unglaubwürdigem und Hanebüchenem.
Flandern, um 1300: Edgar hat seine treue Fidelia zugunsten der verführerischen Tigrana verlassen und beim Abgang kurzerhand sein Haus abgebrannt. Nach einem ausschweifenden Leben wird er aber auch seiner Geliebten überdrüssig. Er geht zu den Soldaten, nimmt an der Schlacht von Courtrai teil, einem Befreiungskampf, bei dem das flandrische Fussvolk den vermeintlich überlegenden Gegner, das Reiterheer des französischen Königs ähnlich raffiniert in die Falle lockt wie die Eidgenossen 15 Jahre später die Habsburger bei Morgarten – eine geschichtliche Pointe, die in St.Gallen unterschlagen wird.
Jedenfalls: Akt drei beginnt als Trauerzug mit leibhaftigem Pferd und einem Sarg, in dem angeblich der heldenhaft gefallene Edgar liegt. Den Trick hat sich Frank, Fidelias Bruder, für Edgar ausgedacht, um die Frauen auf die Probe zu stellen. Quicklebendig und als Mönch verkleidet (Bild oben) hetzt Edgar den Mob gegen sich selber auf. Fidelia aber bleibt ihm, wie es ihr Name verspricht, noch im vermeintlichen Tod treu, während Tigrana sich von Goldgeschenken dazu verführen lässt, ihn zu verfluchen. Und dafür teuer bezahlt.
Die Fremde als Opfer
Ein Charakterlump zwischen zwei Frauen, die er zu den allerschönsten Melodien ins Verderben reitet: Wärs nur dies, so könnte einem diese Oper egal sein. Oper halt.
Aber die Konstellation ist weitaus fataler. Denn Tigrana ist, wie ihr Name andeutet, die Fremde. Vor Jahren mit einem Flüchtlingszug ins Dorf gekommen, hat man sie hier aufgenommen, aber sie bleibt die Aussenseiterin. Im Original ist sie «Moriskin» genannt – Kind maurischer Einwanderer, die in Spanien zum Christentums zwangskonvertiert worden sind. Eine Oper mit Migrationshintergrund, 800 Jahre vor unserer Zeit.
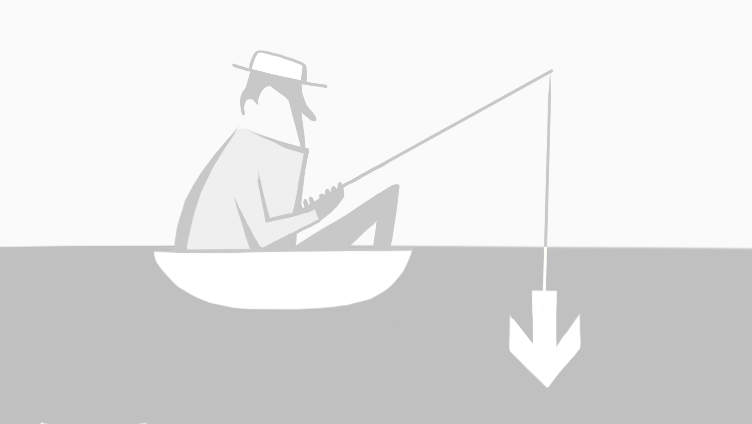
Edgar (Marcello Giordani) und Tigrana (Alessandra Volpe) im Garten der Lüste. Bild: Tanja Dorendorf/Festspiele St. Gallen
Tigrana muss all das verkörpern, was Librettist Fontana und Komponist Puccini Ende des 19. Jahrhunderts in eine solche «femme fatale» und «Zigeunerin» an Männerfantasien hineinschwitzen: Ausschweifung, Blasphemie gegen die Kirche, Erotik, Gefallsucht… kurzum, mit einem immer wieder fallenden Wort: Wollust. Ein «Dämon», «Gift», «Abschaum»– das Libretto strotzt vor verbalen Ausfälligkeiten, von Fremden- und Frauenhass.
Starke Sängerinnen
Alessandra Volpe spielt die Wildheit dieser Tigrana virtuos, das Dunkle ist in ihrer Stimme, ihr Kleid schwarz wie ihre Haare, ihre Wut glaubt man von weit unten her zu spüren, aus Jahrhunderten der Verfolgung. Katia Pellegrinos Fidelia hält wunderbar dagegen, mit schlankem Sopran und einer Innigkeit, die auf der weiten Freilichtbühne alles anders als selbstverständlich ist. Die Männer, Marcello Giordani als Edgar, Evez Abdulla als Frank und Michail Ryssov als Walter, singen imposant, manchmal mit viel rollenbedingter Kraftmeierei.
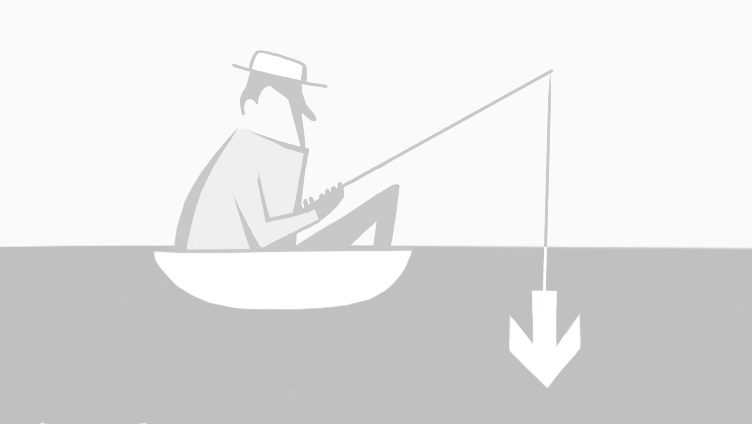
Standhaft gegen die Dämonen: Fidelia (Katia Pellegrino). Bild: Tanja Dorendorf/Festspiele St. Gallen
Puccinis Partitur bietet an Affektladung, an Klangballungen, betörenden Cellokantilenen, Orgelakkorden, Bläserfanfaren und Melodiensüsse alles auf, um nicht nur Edgars Sinne zu betören, sondern auch die des Publikums. Das Sinfonieorchester St.Gallen und die fünf Chöre (darunter auch der Kinderchor des Theaters) geben, dirigiert von Leo Hussain, ihr Bestes.
Je länger der Abend dauert, umso mehr zieht einen diese Musik in Bann. Und dies ist der eine Grund, warum dieser «Edgar» trotz allem den Besuch wert ist: Die Komposition unterläuft gewissermassen das Libretto, sie untermalt mit derselben Klangseligkeit und Ausdrucksheftigkeit das «Böse» wie das «Gute» und hebelt so die simple Schwarzweiss-Moral aus
In Boschs Lustgarten
Das Entscheidende aber leisten Regisseur Tobias Kratzer und Ausstatter Rainer Sellmaier. Grund Nummer zwei, warum sich diese Produktion lohnt, ist die Bühne. Sie ist, in den Akten eins und zwei, ein dreidimensionales Gemälde: Zuerst «übersetzt» Sellmaier das berühmte Zentralbild des Altars von Gent der Gebrüder van Eyck bis ins letzte Kostümdetail auf den Klosterhof, dann wird diese «himmlische» Vision im zweiten Akt verdrängt durch die fantastischen Monster aus dem «Garten der Lüste» von Hieronymus Bosch.
So heiligmässig und statisch das erste Bild wirkt, so humoristisch das zweite. Beide zusammen sagen mit einem Augenzwinkern, und Boschs Esel nickt mit dem Schädel dazu: Das hier ist noch Fantasy. Mittelalterspektakel. Halb so ernst. Noch.
Weitere Bilder (alle von Tanja Dorendorf) aus der Inszenierung
Lynchjustiz
Doch schon da gibt es bedrohliche Zeichen. Der Avvoltoio, der Geier, gespielt vom Tänzer David Schwindling, flattert als Tigranas Schatten gleich ins erste Bild hinein und hackt zum Aktschluss dem Lamm Gottes die Eingeweide aus dem Leib – ein ins Groteske zugespitzter, atemstockender Moment. Von Edgar in die Enge getrieben, ritzt sich Tigrana ihre Unterarme. Die starren Bilder werden bewegt, im dritten Akt sind die Chöre nicht mehr Bildstaffage, sondern, mit Elias Canetti gesagt, «Masse und Macht». Zuerst als Soldateska, die die von Edgar verstossene Tigrana vergewaltigt, dann als Kirchenmeute, deren Requiem einem da schon eher grausig als innig in den Ohren scheppert, ein schwarzgekleideter Mob, bewehrt mit Schirmen, präzis geführt als Menschenkörper, der seine Schlinge immer enger um die Aussenseiterin zieht.
Was der Regisseur damit leistet, ist Grund Nummer drei, sich dem Geschehen auf dem Klosterhof auszusetzen. Je mehr sich der Himmel verdunkelt, desto unbehaglicher – und mitbeteiligter – sitzt man auf seinem Sessel, nimmt mehr und mehr Partei für Tigrana und wird Zeuge einer musikalisch aufgeheizten Fremdenfeindlichkeit, die am Ende in Lynchjustiz mündet. Konsequenterweise ist der Schluss geändert: Statt dass Tigrana wie im Original Fidelia erdolcht, endet die St.Galler Produktion (in einer Szene, die an Strawinskys «Sacre» erinnert) mit der angedeuteten Steinigung Tigranas, während ihre Kontrahentin überlebt.
Die Gesellschaft hat ihr Opfer gefunden. Und die Oper hat ihr Potential behauptet, nicht nur Festivalkulinarik zu bieten, sondern auch Gesellschaftanalyse zu üben.
Dieser Text erschien zuerst auf www.saiten.ch
St. Galler Festspiele
Weitere Vorstellungen von «Edgar»: 3., 6., 7., 11. und 13. Juli, jeweils 21 Uhr, Klosterhof St.Gallen. Mehr zum weiteren Programm der Festspiele gibt es hier: http://www.stgaller-festspiele.ch/de/#programm Dort finden sich auch Informationen zum Ticketverkauf.
Ähnliche Beiträge
Königinnen-Komödie mit Dolmetscher
Drei Diktatorengattinnen und ein Dolmetscher im Schlagabtausch: Das Theagovia Theater bringt Theresia Walsers „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ als Slapstickkomödie ins Theaterhaus Thurgau. mehr
Erwin mit dem Vorschlaghammer
„Mein Leben in H0“ von Giuseppe Spina in der Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5 ist der Monolog eines Modelleisenbahners, der über dem Spielen das Leben verpasst hat. mehr
Vorhang auf!
Wir bieten einen Vorgeschmack auf das, was auf die grossen Bühnen kommt (Teil I) und darauf, was in etwas kleinerem Rahmen im Thurgau sonst noch alles angesagt ist (Teil II). mehr












